weil ich die frühen Erdbeeren kaufen möchte, gehe auch ich, wie ich später feststelle, alle anderen Evoranos, auf die zwei Marktzeilen. Hauptsächlich wird grünes Zeug angeboten, von dem ich das wenigste kenne. Daneben natürlich Unmassen von Zitronen und Orangen mit ihren sonnigen Faben gelb-Orange, Honig und Eier. An zwei Ständen entdecke ich Spargel und Erdbeeren. Oliven habe ich schon, denn auf dem Markt am Dienstag wollte ich „ein paar“ kaufen. Das endete mit 500 g für 1,50 € an denen ich jetzt wohl die nächsten Jahre essen werde. 





 Einiges ist bekannt wie Brunnenkresse, Rote Beete, die Kräuter, wobei Korriander eines der wichtigen Gewürze portugiesischer Küche ist, Spinat, aber was blüht gelb und wird gegessen?
Einiges ist bekannt wie Brunnenkresse, Rote Beete, die Kräuter, wobei Korriander eines der wichtigen Gewürze portugiesischer Küche ist, Spinat, aber was blüht gelb und wird gegessen?
Danach „muss“ es einen Kaffee geben. Im Café Chorizzo gegenüber sitzte ich kaum, schon kommt Ema mit einer ihrer Freundinnen und gesellt sich zu mir. Dann kommt noch Manuela, die immer Frierende, eine weitere Bekannte schaut nur schnell vorbei und wird ausgiebig begrüßt, der Nebentisch an dem inzwischen ca. Acht Personen sitzen gleichfalls. Wir plaudern so über dies und das bis die Beiden mit ihrer kleinen Tochter kommen, die die Organic Farm betreiben. Sie frühstücken hier. Weitere Bekannt und Freunde werden begrüßt, jeder kennt jeden in dieser kleinen Stadt,in der sie alle gern leben. Es wird Mittag, keiner hat es eilig, warum gehen, wenn es sich in der Sonne nett miteinander reden und Neues austauschen läßt? 
 Die lässige Marktrunde
Die lässige Marktrunde
Heute gibt es zum Kaffee zusätzlich eine kleine Zimtstange, mit der die Damen in ihrem Kaffee rühren. Eine kleine Geschmacksnuance zusätzlich. Die Damen mit verwöhntem Gaumen versichern, dass sie höchstens ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag trinken, aber wie kommt dann der hohe Verbrauch in Portugal zu Stande?
Die älteren Damen haben ihre Wintermäntel und -Jacken an, pelzbesetzt, wenn sie das zeigen wollen und können, Touristen laufen in kurzen Hosen durch die Gegend, inWandersandalen und Socken. bleiben wir bei den Vorurteilen: es müssen Engländer oder Amerikaner sein, die so unpassend die Straßen erobern. Chinesische Gästr tragen gern ihren Mundschutz, obwohl die Luft hier gut ist. Inzwischen ist in China eine Modeindustrie drumherum entstanden, die Muster und Farbe des Mundschutzes aus die Kleidung abstimmt.
Aber noch fallen sie hier nicht so stark auf, nochnsind sie die Minderheit, auch wenn die Reiseanalyse der letzen beiden Jahre versichert, dass sie die Gäste der Zukunft sind und zwar massenhaft.
Den Markt selbst und die Kaffees in der Umgebung gehören weiter den Portugiesen, nur wenige Touris verirren sich auf den Platz des 1. Mai und die beiden hinter den Markthallen versteckten Marktstände örtlicher Bauern fallen kaum ins Auge. Da Grünzeug überwiegt, keine Nippes und Souveniers zu kaufen sind, ist das ja „langweilig“. Hatte ich schon berichtet, dass Eier in die Tüte gepackt werden, fast fertig für Rüherei, denn die Portugiesen bringen ihre Eierpackungen natürlich mit. Ich auch, inzwischen.
Was kommt? Lazy Sunday afternoon.



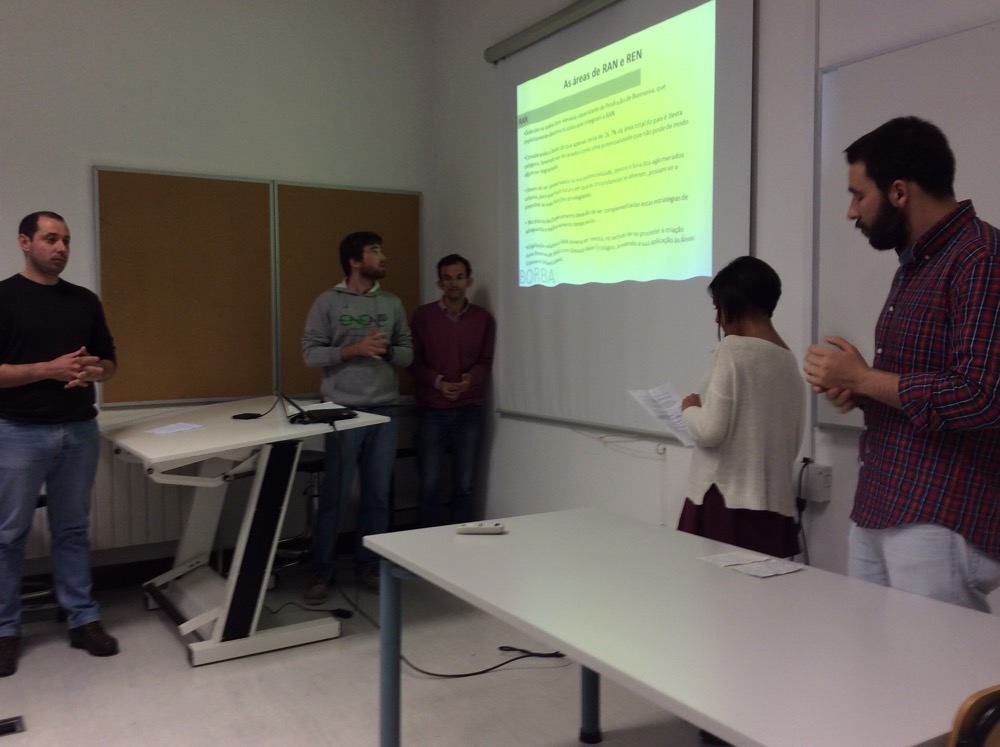


 Die Siedlung Villa Bertha, Lissabon bei einem Spaziergang mit Isabel
Die Siedlung Villa Bertha, Lissabon bei einem Spaziergang mit Isabel  Sozialprojekt Goldener Stern eines Schokoladenfabrikanten
Sozialprojekt Goldener Stern eines Schokoladenfabrikanten Noch ist das Auto wichtiges Statussymbol witschaftlichen Aufstiegs. Lieber wird auf anderes verzichtet. Wer keines vor der Tür hat wird bedauert und gilt als arm – wie schade um die verschenkte „Lebensqualität“ finden wir Nordeuropäer
Noch ist das Auto wichtiges Statussymbol witschaftlichen Aufstiegs. Lieber wird auf anderes verzichtet. Wer keines vor der Tür hat wird bedauert und gilt als arm – wie schade um die verschenkte „Lebensqualität“ finden wir Nordeuropäer Die wunderbare Tassensammlung zum Abschluss
Die wunderbare Tassensammlung zum Abschluss 



 Diese Engelein wohnen in Estremoz im Rathaus und in Evoras Kirchen
Diese Engelein wohnen in Estremoz im Rathaus und in Evoras Kirchen
 Irgendwo an Lissabons Hauswänden
Irgendwo an Lissabons Hauswänden


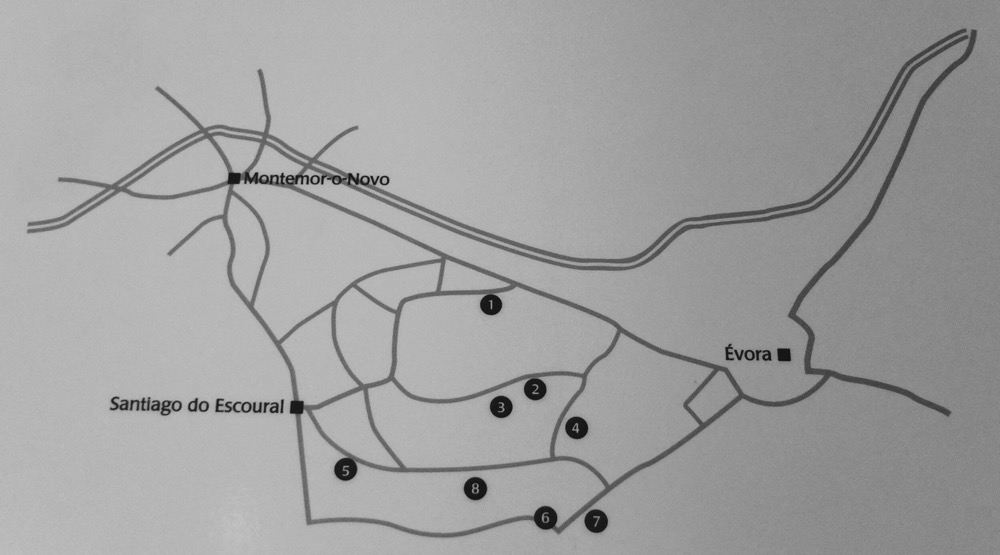







 Lichte Korkeichenhaine überall
Lichte Korkeichenhaine überall





